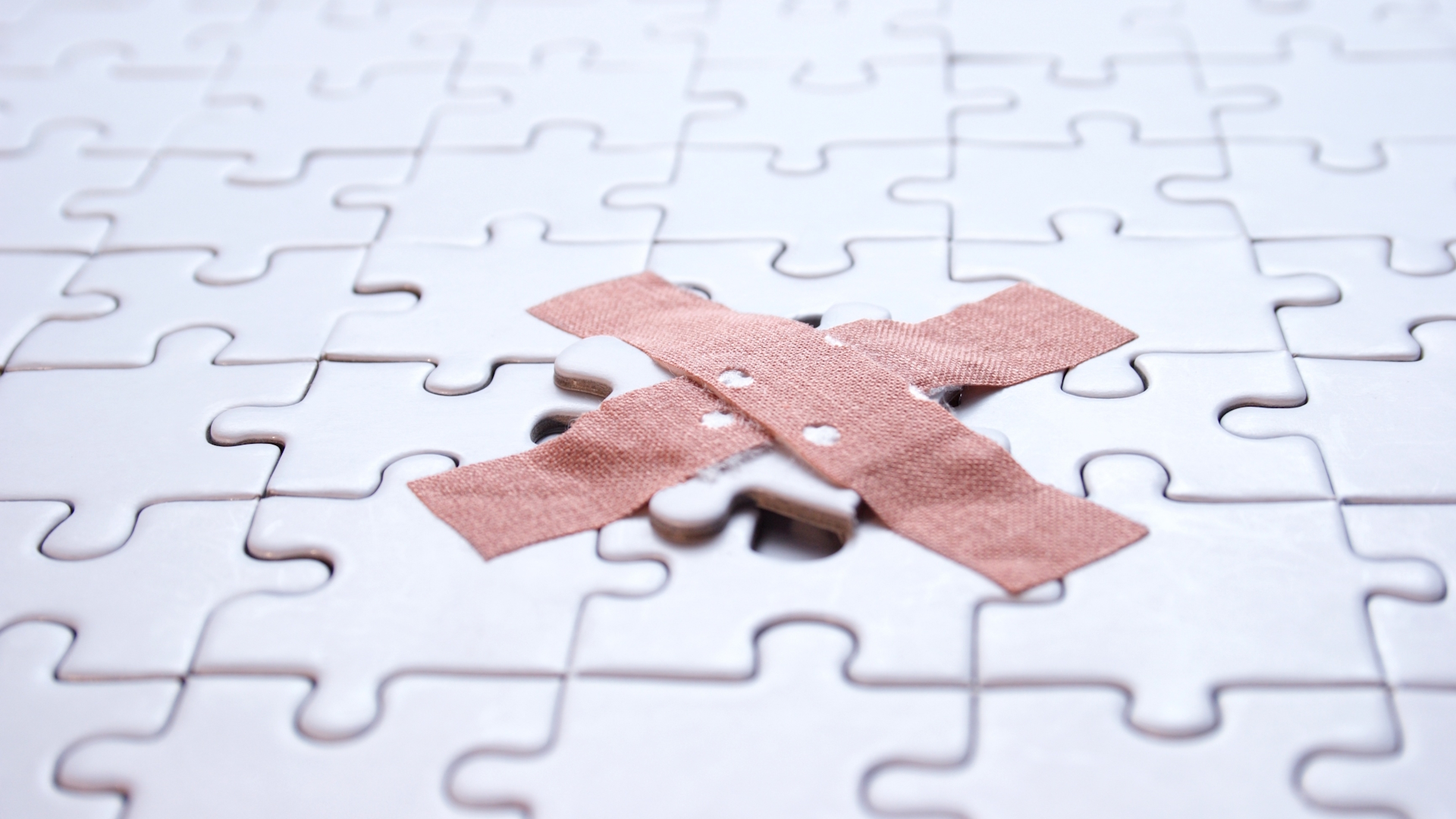Die öffentliche Verwaltung sucht nach Wegen, ihre digitale Unabhängigkeit zu stärken – souveräne Cloud-Lösungen gelten dabei als strategischer Schlüssel.
Wie „CloudComputing-Insider“ berichtet, setzen immer mehr Behörden auf Modelle, bei denen sensible Daten ausschließlich in europäischen Rechenzentren verarbeitet und ausschließlich von EU-Personal betreut werden. Anbieter wie IONOS, Stackit oder Microsoft (mit dem Konzept der „EU Data Boundary“) positionierten sich mit entsprechenden Architekturen, die auf regulatorische Sicherheit und technische Kontrolle zielen.
Doch es geht nicht nur um Datensouveränität. Die Einführung souveräner Cloud-Infrastrukturen erfordert auch eine klare Modernisierungsstrategie auf architektonischer Ebene. Multi-Cloud-Ansätze und hybride Betriebsmodelle setzen voraus, dass bestehende Systeme interoperabel werden – etwa über offene Schnittstellen, standardisierte APIs oder föderierte Datenflüsse. Damit rückt ein altbekanntes Thema in den Mittelpunkt: die Legacy IT der öffentlichen Hand.
Viele zentrale Fachverfahren – von Steuer- und Meldewesen bis zur Sozialverwaltung – laufen nach wie vor auf monolithischen Altsystemen. Diese sind oft tief in die Prozesse integriert, basieren auf Mainframes oder proprietären Datenbankplattformen und wurden über Jahrzehnte gewachsen. Der Übergang in die souveräne Cloud gelingt deshalb nur, wenn diese Strukturen nicht ausgeklammert, sondern bewusst in die Transformationsstrategie eingebunden werden – sei es durch schrittweise Ablösung, technische Kapselung oder gezielte Modernisierung.
Eine aktuelle Lünendonk-Studie zur Cloud-Transformation im öffentlichen Sektor zeigt, dass der Handlungsbedarf erkannt ist. 80 Prozent der befragten Verantwortlichen messen dem Thema eine hohe oder sehr hohe Relevanz bei. Gleichzeitig befinden sich 71 Prozent noch in der Planungs- oder frühen Umsetzungsphase. Nur 18 Prozent der Einrichtungen verfügen laut Studie bereits über eine vollständig implementierte und skalierbare Cloud-Strategie. Bis 2028 rechnen die meisten Verwaltungen damit, 40 bis 60 Prozent ihrer Fachanwendungen in der Cloud zu betreiben; 16 Prozent streben sogar einen noch höheren Anteil an. Bereits heute wird über die Hälfte der neu entwickelten Verwaltungsanwendungen cloud-nativ umgesetzt, ein weiterer Teil ist in Vorbereitung.
Die Studie, veröffentlicht im Frühjahr 2025, benennt auch die wichtigsten Treiber: Neben der erwarteten Skalierbarkeit (84 Prozent) und verbesserten Sicherheitsarchitekturen (79 Prozent) sehen viele Behörden die Cloud als Lösungsweg für den anhaltenden Fachkräftemangel (60 Prozent). Dabei bleibt allerdings offen, ob auch das Wissen über die bestehende Legacy-IT ausreichend dokumentiert und gesichert ist – eine häufig unterschätzte Herausforderung, wenn es darum geht, Altsysteme in neue Architekturen zu integrieren.
Der Beitrag auf „CloudComputing-Insider“ macht indes deutlich, dass souveräne Cloud-Lösungen zwar zentrale technologische und regulatorische Anforderungen adressieren, in der Praxis jedoch oft an den real existierenden IT-Strukturen scheitern können. Damit wird deutlich: Cloud-Souveränität lässt sich nur verwirklichen, wenn auch die Altverfahren und bestehenden Plattformen mitgedacht werden – technologisch, prozessual und personell.
Wer souveräne Cloud-Modelle erfolgreich etablieren will, braucht daher eine klare Antwort auf die Frage, wie mit bestehender Legacy IT umgegangen werden soll. Kapselung, Schnittstellen-Strategien, API-Governance, schrittweises Replatforming und tragfähige Migrationspfade sind zentrale Bausteine einer zukunftsfähigen Architektur. Genauso entscheidend ist der Aufbau interner Kompetenz, um zwischen alten Verfahren und neuen Betriebsmodellen Brücken schlagen zu können.
Die souveräne Cloud kann ein Motor für die digitale Transformation der Verwaltung sein – aber nur dann, wenn sie nicht als Parallelwelt zur bestehenden IT gedacht wird. Vielmehr braucht es ein integriertes Verständnis dafür, wie neue Lösungen die gewachsenen Strukturen ablösen oder mit ihnen zusammenarbeiten können. Andernfalls droht, dass trotz souveräner Plattformen erneut technologische Silos entstehen – nur diesmal in der Cloud.